Am 13.03.2014 stellte die Abgeordnete Rüffer gemeinsam mit ihrer der Grünen-Bundestagsfraktion eine Anfrage an die Bundesregierung zum Thema „Einkommens- und Vermögensanrechnung von Menschen mit Behinderungen“, wogegen sich ja u.A. auch meine Petition richtet.
Zwischenzeitlich erreichte Sie die Antwort (inkl. Anlage) der Bundesregierung.
Zu jener Antwort habe ich eine Einschätzung geschrieben. Nur so viel in Kurz: Die Antworten zeigen, dass sich zumindest momentan scheinbar niemand bewusst ist, warum dieses Thema für so viel Wirbel sorgt.
Fragen Nr. 1 - 3 (Klicken zum Lesen)
Frage Nr. 1:
An welchen Leistungen der Eingliederungshilfe mussten sich nach Kenntnis der Bundesregierung behinderte Menschen (bzw. ihre Angehörigen) in den letzten drei Jahren in welchem Umfang finanziell beteiligen (bitte für die letzten Jahre angeben, für die Zahlen vorliegen)?
Falls der Bundesregierung hierzu keine Angaben vorliegen, plant die Bundesregierung, entsprechende Daten zu erheben?
Frage Nr. 2:
Wie viele Menschen mussten nach Einschätzung der Bundesregierung in den Jahren 2010, 2011 und 2012 vollständig selbst für Unterstützungsleistungen zum Ausgleich ihrer Behinderung aufkommen, weil sie oder ihre Angehörigen nicht als „bedürftig“ eingestuft wurden?
Wie viele dieser aufgrund mangelnder Bedürftigkeit abgelehnten Anträge wurden nach Kenntnis der Bundesregierung nur deshalb abgelehnt, weil ein einmaliger oder kurzfristiger bedarf bestand, der dann z.B. mit den über dem Freibetrag liefernden Ersparnissen oder durch Auflösung einer Versicherung gedeckt werden musste?
Frage Nr. 3:
Wie viele Menschen mussten nach Einschätzung der Bundesregierung in den Jahren 2010, 2011 und 2012 teilweise selbst für Unterstützungsleistungen zum Ausgleich ihrer Behinderung aufkommen?
a) Wie viele dieser Menschen zahlten nach Einschätzung der Bundesregierung monatlich weniger als 50 Euro, wie viele weniger als 100 Euro und wie viele mehr als 500 Euro aus ihrem Einkommen?
b) Wie viele dieser Menschen zahlten nach EInschätzung der Bundesregierung im Jahr unter 500 Euro, unter 1000 Euro und wie viele mehr als 5000 Euro aus eigenem Vermögen?
Antworten auf die Fragen Nr. 1 - 3
Die Fragen 1 bis 3 werden zusammen beantwortet.
Der Bundesregierung liegen zum Umfang der finanzieller Beteiligung an den Leistungen der Eingliederungshilfe und den eigenen Ausgaben behinderungs-
spezifischer Unterstützungsleistungen keine Erkenntnisse vor. Sie hat aber eine Erhebung bei verschiedenen Trägern der Sozialhilfe initiiert, mit der einschlägige Daten gewonnen werden sollen.
Die amtliche SGB XII – Statistik erhebt für den Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Sechsten Kapitel des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB XII) keine Daten über anrechenbare Einkommen oder abgelehnte Leistungen. Insoweit können keine Informationen insbesondere über die Höhe der finanziellen Eigenbeteiligung der betroffenen behinderten Menschen gegeben werden.
Eine Tabelle über die Zahl der Empfänger von Eingliederungshilfe nach Hilfearten für die Jahre 2010 bis 2012 ist als Anlage beigefügt.
Zu den Antworten auf die Fragen Nr. 1 bis 3:
Das Nichterheben von Daten in dieser Sache ist vielen Vertretern schon lange bekannt und sorgt für ein großes Misstrauen gegenüber der Bundesregierung. Befürchtet wird, dass Daten alleine aus dem Grund nicht erhoben werden, da sie die Argumentationslinie vieler Aktivisten befeuern würden.
Besonders interessant ist das im Zusammenhang mit den bürokratischen Kosten, die durch die Prüfung der Einkommens- und Vermögenssituationen von Betroffenen entstehen. Fraglich ist, inwiefern Ersparnisse für den Staat, die durch die Kostenübernahme der Leistungsempfänger erzielt werden, durch die oft aufwendigen Prüfungen aufgefressen werden.
In Bezug auf die angefügte Tabelle stellt sich außerdem die Frage, was für den „Rückgang der Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule“ im Jahr 2012 verantwortlich ist. Bei der Gelegenheit sei zu erwähnen, dass es problematisch ist, diese Hilfe nur für angemessene Berufe zu gewähren. Was für wen angemessen ist, ist am Ehesten von den Betroffenen selbst zu beurteilen und führt in nicht wenigen Fällen zu rechtsgutachterlichen Streitigkeiten.
Fragen Nr. 4 - 6
Frage Nr. 4:
Warum liegen die Familienzuschläge, die behinderte Menschen, die Eingliederungshilfe erhalten, von ihrem Einkommen behalten dürfen, niedriger als die Bedarfssätze der Hilfe zum Lebensunterhalt (Regelbedarfsstufen 2, 3 und 4)? Sieht die Bundesregierung hier Änderungsbedarf? Wenn ja, welchen? Wenn nein, warum nicht?
Frage Nr. 5:
Warum sind die Kosten für Heizung und Warmwasser nicht Teil des Freibetrags von Bezieherinnen und Beziehern von Eingliederungshilfeleistungen, obwohl sie zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum zählen? Sieht die Bundesregierung hier Änderungsbedarf? Wenn ja, welchen? Wenn nein, warum nicht?
Frage Nr. 6:
Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, dass Menschen mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe beziehen, durch die in den Fragen 4 und 5 genannten Regelungen in die Situation geraten können, weniger Geld zum Leben zur Verfügung zu haben, als das sozialhilferechtliche Existenzminimum? Sieht die Budnesregierung hier Änderungsbedarf? Wenn ja, welchen? Wenn nein, warum nicht?
Antworten auf die Fragen Nr. 4 - 6
Die Fragen 4 bis 6 werden zusammen beantwortet.
Die Fragen zielen auf Bestimmungen zur Feststellung existenzsichernder Leistungen (einschlägige Regelbedarfsstufe sowie Einbezug der Kosten für
Heizung und Warmwasser), die unmittelbar keinen Bezug zu Eingliederungshilfeleistungen haben.
Die Regelung zur Einkommensgrenze insgesamt soll sicherstellen, dass dem Betroffenen und den übrigen Mitgliedern der Einsatzgemeinschaft ausreichende eigene Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts verbleiben und eine unzumutbare Beeinträchtigung der Lebensführung vermieden wird. Dadurch wird ein Bedarf festgelegt, der über dem der Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt, die ihr Einkommen grundsätzlich im vollen Umfang einsetzen müssen. Der Einsatz eigener Mittel kann regelmäßig nur verlangt werden, soweit diese eigenen Mittel über der Einkommensgrenze liegen und auch dann nur im zumutbaren Umfang. Ein Einsatz des gesamten Einkommens ist danach also regelmäßig nicht möglich. Bei der Prüfung, welcher Umfang angemessen ist, sind vor allem die Art des Bedarfs, die Art oder Schwere der Behinderung oder der Pflegebedürftigkeit, die Dauer und Höhe der erforderlichen Aufwendungen sowie besondere Belastungen der Personen der Einstandsgemeinschaft zu berücksichtigen. Zudem sind auch hier allgemeine Grundsätze des Sozialhilferechts zu beachten, z. B. der Individualität, des Vorrangs der offenen Hilfe oder der familiengerechten Hilfe. Zudem hat der Gesetzgeber sichergestellt, dass schwerstpflegebedürftigen und blinden Menschen die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen über der Einkommensgrenze maximal nur mit einem Umfang von 40 v. H. zuzumuten ist. Im Einzelfall ist auch eine noch geringere Inanspruchnahme in Betracht zu ziehen. Damit wird dem Sozialhilfeträger für die Anrechnung des Eigenanteils des Betroffenen ein breiter Entscheidungsrahmen eingeräumt, der verhindert, dass existenzgefährdende Härtefälle beziehungsweise Hilfebedürftigkeit eintreten.
Dass ein Mensch mit Behinderungen danach weniger Geld zum Leben zur Verfügung hat, als das sozialhilferechtliche Existenzminimum, ist nicht möglich,
weil zunächst immer der allgemeine Lebensunterhalt festgestellt und gesichert sein muss.
Zu den Antworten auf die Fragen Nr. 4 bis 6:
Es ist durchaus zynisch, in Anbetracht der jetzigen Regelung davon zu sprechen, die gesetzliche Lage vermeide „eine unzumutbare Beeinträchtigung der Lebensführung“. Zu diesem Schluss kann man wohl nur kommen, wenn man die Einkommens- und Vermögensanrechnung ausschließlich getrennt betrachtet. Würde je nur eine gesetzliche Behinderung (!) bei der finanziellen Lebensführung vorliegen, so könnte man sicher darüber streiten, ob dies alleine eine unzumutbare Beeinträchtigung wäre. Eine alleinige, teilweise Anrechnung des Einkommens wäre eine Kompromisslinie, die sich lohnen würde einzugehen. Auch ein alleiniges Begrenzen des Vermögens kann unter ganz speziellen Voraussetzung eine gerade so zu akzeptierende Regelung sein. Beides in Kombination verwehrt aber jegliche finanzielle Freiheit und Teilhabe.
Anmerken möchte ich, dass die Einkommensanrechnung das kleinere Übel ist. Die Beteiligung an den Kosten ist selbst für viele Betroffene nachvollziehbar und durchaus handhabbar. Viel schwerer wiegt die Vermögensanrechnung, die einer lebenslangen und ständigen Enteignung gleichkommt. Wenn schon das Erreichen eines eigenen Einkommens erschwert wird, sollte man zumindest den davon überschüssigen und in der aktuellen Lebenslage nicht gebrauchten Teil als Vermögen behalten dürfen. Zwar würde es in dieser Konstellation schwieriger, kurzfristig mittelmäßige Ausgaben zu tätigen – sofern man nicht über ein überdurchschnittliches Einkommen verfügt – aber langfristig wäre es damit möglich Vermögen aufzubauen um schwerwiegende Ausgaben zu tätigen und dann auch kurzfristig auf bestimmte Lebenssituationen reagieren zu können. Zudem würde es Angehörigen auch ermöglichen, ihr Vermögen an Betroffene zu vererben, was unter aktuellen Umständen kaum möglich ist.
Frage Nr. 7
Frage Nr. 7:
Welche Bundesländer entlasten nach Kenntnis der Bundesregierung Bezieherinnen und Bezieher von Einliederungshilfe, indem sie höhere Grundfreibeträge nach § 86 SGB XII festgesetzt haben? Für welche Leistungsarten gelten diese? Wie hoch liegen sie jeweils? Hat sich diese Vorschrift bewährt?
Antwort auf die Frage Nr. 7
Der Bundesgesetzgeber hat in § 86 SGB XII die frühere Regelung des § 79 Absatz 4 Bundessozialhilfegesetz übernommen, wonach die Länder und die Sozialhilfeträger ermächtigt sind, für einzelne Arten der Hilfen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII höhere Einkommensgrenzen festzulegen. Ob von dieser Ermächtigungsgrundlage Gebrauch gemacht wird, entscheiden die Länder. Der Bund ist hierbei nicht zu beteiligen und es liegen auch keine Erkenntnisse über die Vorgehensweise der Länder und Sozialhilfeträger im Einzelfall vor.
Zu der Antwort auf die Frage Nr. 7:
Es ist mir neu, dass Bundesländer die Einkommensgrenzen selbstständig festlegen können. Diesen Hinweis nehme ich aber gerne auf! Allerdings muss ich dabei auf die obige Stellungnahme zu den Antworten auf die Fragen Nr. 4 bis 6 verweisen. Die alleinige Anhebung der Einkommensgrenze mag für einige Betroffene den Existenzdruck verringern, den es mMn in diesem Maße überhaupt nicht geben dürfte. Es ändert aber nichts an der Problematik, dass man als Betroffener entweder ständig kurzfristige Ausgaben, die nicht vermögensbildend wirksam werden (Wohnraumkauf, Auto, … -> da u.U. zu Vermögen zu zählen und zur Kostendeckung aufzulösen sind), tätigen muss um überhaupt einen Vorteil seiner Arbeit zu erlangen oder das Einkommen spätestens bei der Vermögensbildung für die behinderungsbedingten Hilfen aufzubrauchen hat.
Frage Nr. 8
Frage Nr. 8:
Inwiefern hält die Bundesregierung es für angemessen, dass viele Sozialhilfeträger bei Beziehern von Eingliederungshilfe die Eigenbeteiligung laut Berichten von Leistungsberechtigten häufig auf den höchsten möglichen Betrag festlegen? Welche Schlussfolgerungen bzw. Konsequenzen zieht die Bundesregierung daraus, dass einige Sozialhilfeträger, die für schwertpflegebedürftige und blinde Leistungsbezieher geltende Begrenzung des Eigenanteils auf 40 Prozent des Einkommens umgehen, indem sie die Leistung aufspalten und für jeden Teil den Einsatz von 40 Prozent des noch nicht eingesetzten Einkommens verlangen?
Antwort auf die Frage Nr. 8
Die Durchführung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII und damit auch die sozialhilferechtliche Entscheidung im Einzelfall obliegt den Behörden in den Ländern, die der Aufsicht des Bundes nicht unterliegen. Eine Verwaltungspraxis – wie in der Frage dargestellt – mit der die Leistungen aufgespalten werden, um die Begrenzung des Eigenanteils zu umgehen, ist der Bundesregierung nicht bekannt.
Zu der Antwort auf die Frage Nr. 8:
Eine individuelle Betrachtung im Einzelfall erfolgt mMn nicht in allen Fällen. Natürlich ist es ein Einfaches die Verantwortung für die Praxis den Ländern und Kommunen zuzuschieben. Die Grundlage für Missbrauch und Überstrapazierung von Instrumenten bilden aber bundesgesetzliche Regelungen.
Frage Nr. 9
Frage Nr. 9:
Hält es die Bundesregierung für angemessen, dass sich behinderte Menschen, die ihre finanzielle Beteiligung an der Sicherung ihrer Teilhabe steuerlich geltend machen, mit der Steuererstattung wieder finanziell an den Eingliederungshilfeleistungen beteiligen müssen? Wenn ja, warum?
Antwort auf die Frage Nr. 9
Die Steuererstattung zählt zum Einkommen des behinderten Menschen. Es ist daher ebenso wie anderes Einkommen zu berücksichtigen, allerdings nur unter den in der Antwort zu den Fragen 4 bis 6 erwähnten einkommensrechtlichen Einschränkungen.
Zu der Antwort auf die Frage Nr. 9:
Die Absurdität einer „Besteuerung“ der Steuererstattung sollte klar sein.
Fragen Nr. 10 - 11
Frage Nr. 10:
Aus welchen Gründen hält die Bundesregierung es für angemessen, dass alleinstehende Menschen mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe beziehen, ihren Lebensunterhalt aber selbst bestreiten, in der Regel nicht mehr als 2600 Euro ansparen dürfen, was deutlich unterhalb der Grenze des Schonvermögens für Bezieher von Arbeitslosengeld II liegt?
Frage Nr. 11:
Hält es die Bundesregierung für angemessen, dass die Vermögensfreibeträge für behinderte Menschen, die Eingliederungshilfe beziehen, und deren Angehörige seit dem Jahr 2005 nicht angehoben wurden? Wie hoch müssten die Freibeträge aktuell sein, wenn sie jährlich an die Inflationsrate angepasst worden wären? Sieht die Bundesregierung hier Handlungsbedarf, und wenn ja, welchen?
Antworten auf die Fragen Nr. 10 - 11
Die Fragen 10 und 11 werden zusammen beantwortet.
Der Gesetzgeber hat ausdrücklich nur einen „kleineren“ Barbetrag geschützt. Das entspricht dem Grundsatz, dass die Sozialhilfe als bedürftigkeitsabhängiges Leistungssystem allgemein den Einsatz von Einkommen und Vermögen des Betroffenen verlangt.
Trotzdem hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass dieser Barbetrag bei Vorliegen einer besonderen Notlage auch erhöht werden kann. Dies ermöglicht, angemessen auf die individuelle Situation des betroffenen Menschen einzugehen.
Soweit die Frage auf einen Vergleich mit den Grenzen des Schonvermögens für Bezieher von Arbeitslosengeld II zielt, ist festzustellen, dass das Schonvermögen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts betrifft und durch den Gesetzgeber bewusst großzügiger ausgestaltet worden ist, da die beiden Leistungssysteme im Sozialhilferecht (SGB XII) und in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) unterschiedliche Zielvorstellungen enthalten. Beim SGB II steht das Fördern und Fordern stark im Vordergrund. Das in § 1 SGB II normierte wichtigste Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist es durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass der Hilfesuchende durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit seine Hilfebedürftigkeit zügig und vollständig überwindet. Demgegenüber sind die Regelungen im Recht der Sozialhilfe flexibel angelegt. Durch die Anwendung der Härtefallregelung ist es möglich, dass der Betrag für das Schonvermögen auch über dem nach dem SGB II gewährten Betrag liegen kann. Eine jährliche Anpassung an die Inflationsrate hat nicht stattgefunden. Der Freibetrag in Höhe von 2 600 Euro beliefe sich, eine Anpassung an die jährliche Inflationsrate unterstellt, im Jahr 2013 auf ca. 2 970 Euro.
Die Art und Weise der Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen in der Eingliederungshilfe wird im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes für Menschen mit Behinderungen ein wichtiger Diskussionspunkt sein.
Zu den Antworten auf die Fragen Nr. 10 und 11:
Ich möchte mich zunächst schon jetzt entschuldigen, für ggf. unparlamentarisch fallende Aussprüche. Aber die Antworten auf die ab hier gestellten Fragen sind an Ignoranz gegenüber der UN-Behindertenrechtskonvention unübertroffen.
Wenn man das Vorwort der Bundesregierung mit den Antworten vergleicht, stellt man fest, dass es mit Nichten bereits 2001 zu einer Änderung der Sichtweise auf das Thema gekommen ist. Spätestens bei der Feststellung, dass durch die systematische Zuweisung der Eingliederungshilfe in die Sozialhilfe der Grundsatz des „bedürftigkeitsabhängigen Leistungssystem“ gefolgt werden muss, stellt die gesamte Problematik dar. Die alleine auf medizinische / körperlichen Beeinträchtigungen von Menschen mit Behinderungen beruhende Notwendigkeit der Hilfen ist eben kein Signal für Bedürftigkeit. Die Hilfen sind nur in Anbetracht von mangelnden medizinischen Möglichkeiten oder fehlenden „technischen Hilfsmitteln“ nötig.
Das der Gesetzgeber die Möglichkeit der Erhöhung des Barbetrages im Vorliegen einer Notlage vorsieht ist an Widersprüchlichkeiten nicht zu überbieten. Auf der einen Seite wird die „Behinderung“ als ein Grund für die Zuweisung in die Sozialhilfe gewertet, auf der anderen Seite ist sie selber aber scheinbar noch nicht Grund genug, um generell eine Notlage zu rechtfertigen (,was weiter unten übrigens dadurch bejaht wird, dass sich der Betroffene aus seiner „Notlage“ selber zu befreien hat). Aus meiner Sicht ist das nicht stringent argumentiert. Entweder die Behinderung ist eine lebenslage Beeinträchtigung, die berechtigt, Hilfen in Anspruch zu nehmen, die an sich schon nur für Notlagen konzipiert sind. Denn genau dafür sind Sozialhilfen da. Dann müsste man auch hier die besondere Notlage immerzu bejahen. Oder aber, die Behinderung ist keine lebenslage Beeinträchtigung, die der Sozialhilfe zuzuordnen ist, womit es automatisch zu keiner Vermögens- und Einkommensanrechnung kommen kann.
Interessanterweise scheint das auch die Bundesregierung bemerkt zu haben, da sie im Folgenden die Unterschiede in der Zielsetzung der Grundsicherung und der Eingliederungshilfe darstellt. Fraglich ist aber, warum mit Hinblick auf eine (im Idealfall) kurzfristige Sozialhilfe geringere Kostenbeteiligungen als richtig empfunden werden als bei denjenigen, die völlig unabhängig von ihrer eigenen Leistungsfähigkeit auf die Hilfen angewiesen sind und es so für den Betroffenen, insbesondere unter den jetzigen finanziellen Beschränkungen, absolut keine Rolle spielt, ob er einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder nicht. Menschen, die nur kurzfristig auf Hilfen angewiesen sind, zu Lasten derer finanzielle beizustehen, die unter normalen Umständen nie in ihrem Leben auf die Hilfen verzichten werden können, ist eine fehlgeleitete Steuerung. Daher drängt sich auch die Frage auf, warum ausgerechnet für die Hilfen des SGB, denen eine stabile Grundlage für die Gewährung der Hilfen zugrunde liegt (Behinderung meist lebenslang) flexiblere Mechanismen zur Verfügung stehen als bei den Hilfen, die sich kurzfristig ändern können (Arbeitssuchende / Grundsicherung). Flexibel bedeutet in diesem Zusammenhang natürlich, dass es nur in absoluten Sonderfällen zu einer Anhebung des Schonvermögens kommen kann, im Generellen aber ein niedrigeres Schonvermögen angesetzt wird.
Frage Nr. 12
Frage Nr. 12:
Hält die Bundesregierung die in Frage 10 und 11 genannten Freibeträge für ausreichend, um Geld für unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen anzusparen, wenn man berücksichtigt, dass mit den genannten Summen auch der Lebensunterhalt bestritten werden muss? Wenn ja, warum?
Antwort auf die Frage Nr. 12
Notwendige Leistungen, die sich auf unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen an Gegenständen behinderungsspezifischen Bedarfs beziehen, werden durch die Eingliederungshilfe gedeckt. Nach der Vorbemerkung der Fragesteller ist der Lebensunterhaltsbedarf des hier betroffenen Personenkreises gedeckt. Ergänzend wird auf die Antwort zu den Fragen 4 bis 6 verwiesen.
Zu der Antwort auf Frage Nr. 12:
Wieso ist die Bundesregierung der Meinung, dass Menschen mit Behinderungen nur ein Recht auf Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bei „behinderungsspezifischen Bedarfen“ haben? Es wird bewusst ausgeblendet, dass behinderte Menschen ebenso das Verlangen nach anderen Gütern und Bedarfen haben. In dieser Antwort steckt der Pudels Kern. Die Bundesregierung ist der Meinung, das behinderte Menschen nur ein Anrecht auf lebensnotwendige und „behindertenspezifische“ (wer auch immer das definiert) Bedarfe haben und das auch noch unabhängig von der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
Diese Ansicht widerspricht fundamental der UN-Behindertenrechtskonvention:
„Artikel 28 Abs. 1: Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf einen angemessenen Lebensstandard für sich selbst und ihre Familien, einschließlich angemessener Ernährung, Bekleidung und Wohnung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirklichung dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung.“
Das Gewähren von lebensnotwendigen Hilfen mit Verknüpfung an die Bedingung, den eigenen Lebensstandard nur auf den fundamentalsten Teil, sowie dem undefinierten behindertenspezifischen Bedarf zu beschränken, steht im Widerspruch mit dem Recht auf „stetige Verbesserung der Lebensbedingungen“, die eben in der Konsequenz auch oberhalb der minimalen Lebensstandards liegen können. Zu beachten ist, dass dies ein Recht ist, dass von den Betroffenen natürlich selbst erreicht werden muss. Dabei dürfen sie aber nicht aufgrund von Behinderung diskriminiert werden, wie es zur Zeit der Fall ist!
Frage Nr. 13
Frage Nr. 13:
Ist aus Sicht der Bundesregierung gewährleistet, dass behinderte Menschen, die Eingliederungshilfe beziehen, mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Einkommen oder Vermögen auch behinderungsbedingte Ausgaben finanzieren können, die nicht durch Leistungen zur Teilhabe gedeckt werden? Wenn ja, wie?
Antwort auf die Frage Nr. 13
Mit dem offenen Leistungskatalog in der Eingliederungshilfe (§ 54 SGB XII) steht ein Förderinstrumentarium zur Verfügung, das – Bedürftigkeit des Antragstellers und den Ausschluss vorrangiger Leistungsansprüche vorausgesetzt – in allen individuellen Bedarfssituationen eine umfassende Deckung behinderungsspezifischer Rehabilitations- und Teilhabebedarfe im erforderlichen Rahmen ermöglicht. Die sich in der Frage widerspiegelnde Problematik stellt sich insoweit aus Sicht der Bundesregierung nicht.
Zu der Antwort auf Frage Nr. 13:
Oben geschilderte Problematik spiegelt sich hier ebenfalls wieder, wenn von „Bedürftigkeit des Antragstellers […] vorausgesetzt“ gesprochen wird. Nur wer in finanzieller Hinsicht bedürftig ist, erhält Hilfen die er wegen seiner Behinderung benötigt. Die Verknüpfung von lebensnotwendigen Hilfe an finanzielle Bedürftigkeit ist einem Staat wie Deutschland nicht würdig.
Frage Nr. 14
Frage Nr. 14:
Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die Heranziehung des Einkommens und Vermögens von Ehe-, Lebens- und nicht-ehelichen Partnern die Wahrscheinlichkeit, dass Bezieher von Eingliederungshilfe eine Familie gründen können, deutlich senkt, weil die Aussicht auf ein Leben in Armut viele potenzielle Partner abschreckt? Ist dies mit den Grund- und Menschenrechten vereinbar?
Antwort auf die Frage Nr. 14
Die Auffassung, dass die Eheschließung bzw. Partnerschaft von behinderten Menschen bei Sozialhilfegewährung unerträglich belastet würde, kann nicht überzeugen. Bei einer Partnerschaft spielen in unserer Gesellschaft primär persönliche Aspekte eine Rolle. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass eine Heranziehung des Einkommens und Vermögens von Ehe-, Lebens- und nicht-ehelichen Partnern im Rahmen einer sozialhilferechtlichen Einsatzgemeinschaft nicht gegen Grund und Menschenrechte verstößt.
Zu der Antwort auf Frage Nr. 14:
Ich bin geneigt, auf diese plumpe Antwort ebenso polemisch zurückzufragen: Warum gibt es dann im deutschen (Steuer-)Recht eine hohe Anzahl an finanziellen Anreize für die Eheschließung? Ebenfalls frage ich mich, ob man an die Möglichkeit einer Familiengründung nicht denken wollte oder schlicht vergessen hat. Beides wäre ein Ausdruck des fehlenden Verständnisses für das heutige Selbstbild von Menschen mit Behinderungen. Das sich der Mensch, der Hilfen vom Staat aufgrund seiner individuellen körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen erhält, an den Kosten beteiligen soll ist nachvollziehbar und kann durch den Erhalt einer teilweisen Einkommensanrechnung erzielt werden (s. oben). Dass aber das Sozialleben dramatisch durch die aktuelle Regelung behindert wird, zeigt sich in den Versuchen von Betroffene, diese zu umgehen. Befindet man sich in einer Partnerschaft, so wird nur dann der Lebenspartner mit einbezogen, wenn er seinen Wohnsitz mit dem des Partners teilt (keine judikative Darstellung). Die Lösung für viele Paare mit einem behinderten Menschen ist daher die Aufrechterhaltung von mindestens zwei Wohnsitzen. Alleine aus diesem Grund stellen sich finanzielle Mehrbelastungen gegenüber Paaren ohne behinderten Menschen.
Es ist Realitätsverweigerung, wenn die Bundesregierung annimmt, dass es die Wahrscheinlichkeit für einen Menschen mit Behinderung nicht senkt, wenn er dem potenziellen Partner offenbaren muss, dass jener beim Eingehen der Partnerschaft automatisch zum Sozialhilfeempfänger wird. Selbstverständlich senkt es auch die Wahrscheinlichkeit eine Familie zu gründen, wenn die beide Elternteile zu Sozialhilfeempfängern würden.
Jeder Mensch mit Behinderung ist, sofern er die Behinderung seit der Geburt hat, ein geborener Sozialhilfeempfänger – vom ersten bis zum letzten Atemzug. Alleine diese Tatsache müsste schon ausreichen um den Gesetzgeber zu einer Änderung zu veranlassen und eine Diskriminierung durch die aktuelle Gesetzeslage zu bejahen. Das zeitgleich aber eine Art Sippenschaft erzeugt wird, ist unhaltbar. Es ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen selbst, sondern auch für die Partner, denen der Staat damit zum Ausdruck bringt , wie sehr er es schätzt (oder eben nicht), dass diese Menschen Verantwortung übernehmen und mit den Staat entlasten.
Frage Nr. 15
Frage Nr. 15:
Ist es mit den Benachteiligungsverboten des Grundgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbar, von auf Leistungen zur sozialen Teilhabe angewiesenen Menschen und deren Familien zu verlangen, unabhängig von ihrem beruflichen Status ein Leben in der Nähe der Armutsschwelle zu führen? Wenn ja, warum?
Antwort auf die Frage Nr. 15
Der die bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen der Sozialhilfe prägende Grundsatz der Nachrangigkeit bedingt, dass der Leistungssuchende regelmäßig vorrangig seine eigenen Kräfte und Mittel zwingend zur Behebung seiner Notlage einsetzen muss. Erst dann, wenn diese Möglichkeiten der Selbsthilfe nicht vorhanden sind oder nicht ausreichen, werden öffentliche Leistungen gewährt. Dabei hat der Gesetzgeber gewisse Einkommens- und Vermögensgrenzen für das Eingreifen der Sozialhilfe gesetzt. Die den Leistungsberechtigten zuerkannten Bedarfe in der Sozialhilfe stellen sicher, dass der für ein menschenwürdiges Existenzminimum erforderliche Bedarf abgedeckt wird. Wie daraus eine vermeintliche Benachteiligung abgeleitet werden kann, ist nicht ersichtlich.
Zu der Antwort auf Frage Nr. 15:
Das auch hier von einer Notlage gesprochen wird, ist absurd. Eine Behinderung ist keine dauerhafte Notlage. Sie wird erst durch die aktuelle Armutsfalle „Hilfe durch den Staat“ zu einer. Auch ist es nun einmal für den Betroffenen selber unmöglich sich aus seiner Notlage „Behinderung“ zu befreien. Davon zu sprechen, dass die Hilfe des Staates nachrangig zur Anstrengung des Leistungssuchenden sein sollte ist grotesk. Behinderten Menschen zu sagen, man helfe ihnen erst, wenn sie versuchten, nicht mehr behindert zu sein, ist lächerlich.
Zudem gibt die Bundesregierung zu, dass sie Menschen mit Behinderungen nicht mehr als das „menschenwürdige Existenzminimum“ zugesteht. Inwiefern sich die Bundesregierung damit von der Behindertenpolitik von vor über 40 Jahren löst, scheint nur ihr selbst klar zu sein.
Frage Nr. 16
Frage Nr. 16:
Wie bewertet die Bundesregierung die Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, die Eingliederungshilfe beziehen, privat für das Alter bzw. für die Nacherwerbsphase vorzusorgen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele Sozialhilfeträger von Empfängerinnen und Empfängern von Eingliederungshilfeleistungen die Auflösung nicht-riestergeförderter Rentenversicherungen fördern, auch wenn sie vor der Einführung der Reisterrente abgeschlossen wurden oder der Rückkaufswert niedriger ist als die Summer der bisher gezahlten Prämien?
Antwort auf die Frage Nr. 16
Die Frage, ob angespartes Altersvorsorgekapital von der Sozialhilfe geschont wird, ist eine Einzelfallentscheidung des zuständigen Sozialhilfeträgers. Für nicht unter den generellen Schutz der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge fallende andere private Altersvorsorge hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass bei Vorliegen einer Härte auch in diesen Fällen keine Verwertung des Vermögens verlangt werden darf. Diese Härte ist bei der Eingliederungshilfe zu unterstellen, wenn die Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssicherung wesentlich erschwert würde.
Zu der Antwort auf Frage Nr. 16:
Durch dieses Vorgehen provoziert der Gesetzgeber, dass der Leistungsempfänger (zzgl. seiner Partnerin / Partner) spätestens im Alter erneut auf die Hilfe des Staates angewiesen ist (sind). Die Betroffenen verkommen damit zu einem Spielball in der fiskalischen Langzeitplanung. Es werden kurzfristig Kosten vermieden, nur um zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund von fehlender Verzinsung stärker helfen zu müssen.
Welche Forderungen müssen als Minimum bei einer gesetzlichen Änderung erfüllt werden?
- Wegfall der Vermögensanrechnung
- Beschränkung der Einkommensanrechnung auf Einkommen durch Erwerbsarbeit und selbstständige gewerbliche Tätigkeiten
- Anheben des Einkommenfreibetrages
- Kopplung des Einkommenfreibetrages an die Inflationsrate
- Befreiung der Lebens-, Ehe und nicht-eheliche Partnerschaften von der Einkommens- wie auch Vermögensanrechnung
————————————————

Einschätzung zur Anfrage „Armut durch Eingliederungshilfe“ von Constantin Grosch ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.


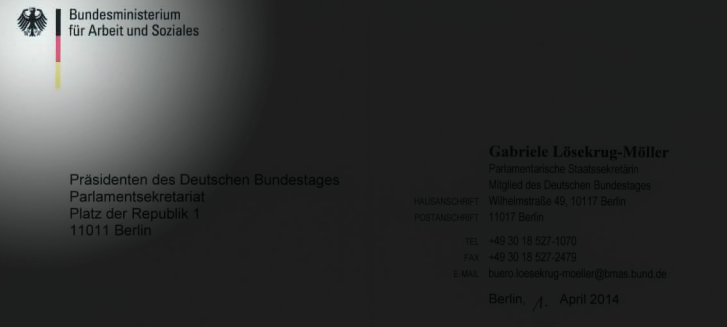
 Constantin Grosch, Inklusionsaktivist, Kreistagsabgeordneter, Kuratorium & Forum Inklusion Hameln, Aufsichtsratsvorsitzender VHP/Öffis
Constantin Grosch, Inklusionsaktivist, Kreistagsabgeordneter, Kuratorium & Forum Inklusion Hameln, Aufsichtsratsvorsitzender VHP/Öffis
Trackbacks/Pingbacks